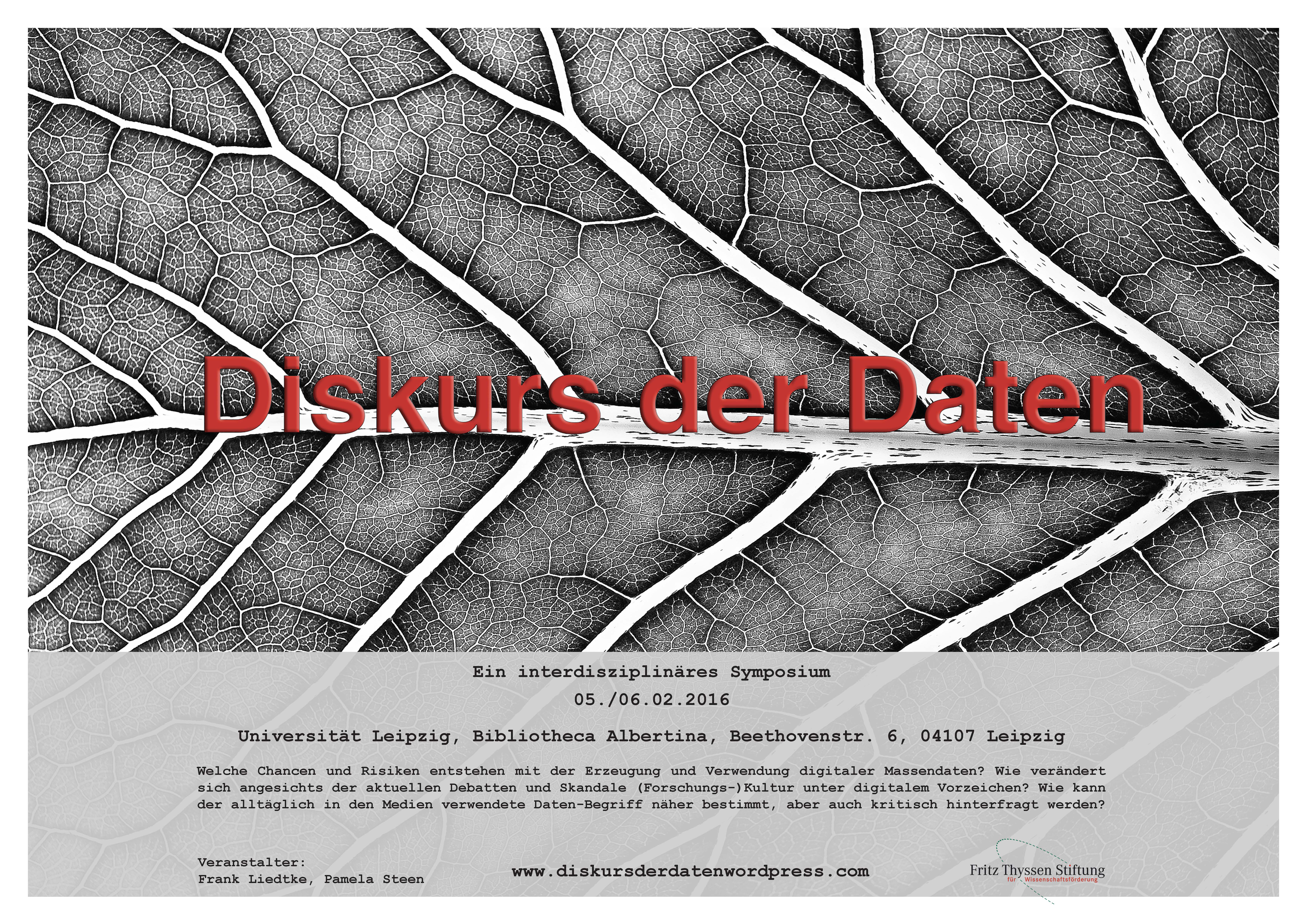Tierlinguistik
Gegenstand – Ausrichtungen – Themen – Ziele
Zwar löst sich die allgemeine Tiervergessenheit in vielen Disziplinen langsam auf, sie gilt aber noch für die Sprachwissenschaft, wenngleich Tiere auch hier seit den 1980er Jahren langsam ins Forschungsinteresse rücken. Mit diesem pragmalinguistischen Projekt erfolgt nun erstmals eine umfassende theoretische und methodische Neuausrichtung einer Kulturlinguistik als Tierlinguistik im Anschluss an die Human-Animal Studies bzw. Cultural Animal Studies, in denen sich bereits eine Tiersoziologie (z.B. Wiedenmann 2009), Tierphilosophie (z.B. Wild 2008), Tierethik (z.B. Schmitz 2014), Tiermedienwissenschaften (z.B. Bolinski/Rieger 2019), Tiergeografie (z.B. Philo/Wilbert 2000), die Cultural and Literary Animal Studies (z.B. Borgards 2016) sowie die Zoosemiotik 2.0 (Marrone/Mangano 2018) formiert haben. Mensch-Tier-Begegnungen werden aus einer interdisziplinären Perspektive betrachtet.
Die Tierlinguistik untersucht, wie Menschen und Tiere gemeinsam mittels verschiedener Praktiken kommunikative Situationen hervorbringen und gestalten und dabei interspezifische NaturKulturen konstituieren. Der hier vertretene posthumanistische Ansatz stützt sich auf praxisorientierte Ansätze (vgl. Hirschauer 2016), sodass auch die körperlich hervorgebrachten multimodalen Ko-Aktivitäten von Menschen und Tieren in gemeinsamen Praktiken in den Blick geraten.
Dabei werden die Methoden der Gesprächs-, Interaktions-, Diskurs- und Medienlinguistik sowie der Linguistic Landscape Forschung entsprechend angepasst und zentrale Begriffe wie Kommunikation, Empathie, Agency, Emotionalität in Hinblick auf die Erfordernisse einer Erforschung interspezifischer Interaktionen modelliert.
Mit der Ausrichtung auf interspezifische Interaktion ist dieser posthumanistische Ansatz grundsätzlich anschlussfähig für die Forschungen zur Netzwerkbildung mit unbelebten Akteur*innen und der Mensch-Maschine-Kommunikation, wie dies theoretisch in den Ansätzen des New Materialism und von Donna Haraway, Bruno Latour oder Karen Barad erfolgt.
Mit der Bezugnahme auf posthumanistische Arbeiten kann die Tierlinguistik mit entsprechenden Forschungsfragen dem Umstand Rechnung tragen, dass das soziale Mensch-Tier-Verhältnis mit all seinen vielfältigen Ausprägungen im gegenwärtigen Anthropozän einen elementaren, mitbestimmenden Raum einnimmt. So wirken sich ökologische und ökonomische Aspekte – etwa die Massentierhaltung, die Zerstörung des Lebensraums wildlebender Tiere – nicht erst seit der aktuellen Corona-Pandemie (mit sich verbreitenden Zoonosen) auf diverse Lebenswelten aus, die von Menschen und Tieren gemeinsam hervorgebracht werden. Daher wird auch die linguistische Beschäftigung mit Menschen und Tieren in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen, da ökologische Fragen (z.B. zum weltweiten Artensterben, zum Klimawandel) längst auch kulturwissenschaftliche Disziplinen erreicht haben (z.B. Nachhaltigkeit, vgl. Mattfeld/Schwegler/Wanning 2021, Forschungsfeld Ecocriticism u.a.). Es werden anthropozentrische Denkmuster und Wissensanordnungen, aber auch wissenschaftliche Methoden ins Visier genommen, die traditionelle hierarchisierende Grundlagen des Humanismus hinterfragen. Die Tierlinguistik fügt sich in diese neuen Forschungsbereiche ebenso ein wie in pragmalinguistische Bereiche, die unter der Berücksichtigung einer gegenstandsfundierten Methodik systematische linguistische Strukturen rekonstruieren.
Kooperationen und Netzwerke
Projektleitung der Wissensdomäne „Tier – Mensch – Maschine“ im Heidelberger Forschungsnetzwerk Sprache und Wissen (SuW).
Mitglied im Forschungsnetzwerk CLAS – Cultural and Literary Animal Studies, Goethe Universität Frankfurt am Main.
Abgeschlossenes Buchprojekt: Monografie
Steen, Pamela (2022): Menschen – Tiere – Kommunikation. Praxeologische Studien zur Tierlinguistik. (Cultural Animal Studies, Bd. 11, herausgegeben von Roland Borgards) Berlin: J.B. Metzler/Springer Nature. (SpringerLink)
Zum Inhalt
1. Grundlegung eines Forschungsparadigmas: Tiere und Linguistik – Tierlinguistik. Es werden die bisherigen linguistischen Forschungsinteressen mit Bezug auf das kommunikative Mensch-Tier-Verhältnis skizziert und es wird ausgeführt, welche interdisziplinären Anschlüsse an andere Disziplinen der Human-Animal bzw. Cultural Animal Studies möglich und nötig sind.
2. Theoretische und methodische Prämissen zur Mensch-Tier-Kommunikation. Mit Bezug auf vier relevante Forschungsrichtungen (Gesprächslinguistik, Reflexive Anthropologie, Systemtheorie, praxeologische Zugänge) wird diskutiert, welche methodologischen und theoretischen Prämissen für die Tierlinguistik übernommen werden können, welche modifiziert werden müssen, damit Tiere gleichermaßen als soziale Akteur/innen modelliert werden können und damit anthropologische Differenzen aufgebrochen werden können.
3. Zentrale Aspekte tierlinguistischer Analysen. Es werden humanimalische (vgl. Wiedenmann 2009) Begegnungen, die relationale Agency von Tieren sowie interspezifisches Placemaking untersucht. Im Zentrum stehen die Aspekte Zwischenleiblichkeit und Positionalität (vgl. Merleau-Ponty 1966; Plessner 1975), Relationalität und Agency (vgl. Latour 2015), ein diskurs- und literaturlinguistischer Blick auf die sprachliche Konstruktion tierlicher Agency und die zeichenhafte Mensch-Tier-Weltung (vgl. Descola 2014; Philo 1995) durch die geosemiotische Verortung von Tieren mittels Tierschildern als Akte des Placemaking (vgl. Busse und Warnke 2014).
4. Fallstudie: ‚Kontaktzone‘ Zoo. Die Fallstudie basiert auf dokumentierten Zoogesprächen von Besucher/innen sowie auf der Beschilderung im Zoo. Die Analysen schließen an die bereits in der Gesprächslinguistik bzw. Ethnomethodologie erfolgten Studien zur Mensch-Tier-Kommunikation an. Die Studien werden damit um die bisher kaum untersuchte kommunikative Gattung der Zoogespräche erweitert. Es werden typische Merkmale der Gattung beschrieben, die eng mit einer kommunikativen Aneignung der Tiere durch die Besucher*innen verflochten ist. Weitere Praktiken sind das Anthropomorphisieren, sprachliche Figuralisieren und Literarisieren von Tieren.
Weitere erschienene Publikationen
Steen, Pamela/Gnau-Franké Birte C. (2024): "Ist es obszön, einen Abschiedsbrief an ein Haustier zu schreiben?" – Tiere als Adressat*innen in (offenen) Briefen und (anderen) Social-Media-Formaten. In: Schwegler, Carolin/Steen, Pamela (Hrsg.): Mediale Identitäten – multimodal und mehrsprachig. Themenheft LiLi – Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik.
Rettig, Heike/Steen, Pamela (Hrsg.)(2024): Mensch-Tier-Praktiken aus interdisziplinärer Perspektive. Emotionen, Empathie, Agency. Berlin: J.B. Metzler.
Rettig, Heike/Steen, Pamela (2024): Einleitung: Mensch-Tier-Praktiken aus interdisziplinärer Perspektive. Emotion, Empathie, Agency. In: Rettig, Heike/Steen, Pamela (Hrsg.): Mensch-Tier-Praktiken aus interdisziplinärer Perspektive. Emotionen, Empathie, Agency. Berlin: J.B. Metzler. S. 1–24.
Steen, Pamela (2024): Vom 'Zootier‘ zum TV-Tier. Praktiken der Inszenierung interspezifischer Emotionsgemeinschaften in Zoo-Doku-Soaps. In: Rettig, Heike/Steen, Pamela (Hrsg.): Mensch-Tier-Praktiken aus interdisziplinärer Perspektive. Emotionen, Empathie, Agency. Berlin: J.B. Metzler, S. 105–142.
Steen, Pamela (2024): True Love? Inszenierte Tierliebe in Zoo-Doku-Soaps. In: Klug, Nina-Maria/Lautenschläger, Sina (Hrsg.): True Love – Sprache(n) der Liebe in Text und Gespräch. Tübingen: Narr Francke Attempto, S. 239–264.
Böhm, Alexandra/Steen, Pamela (Hrsg.) (2023): Mehrdeutigkeit und Unsicherheit in Tier-Mensch-Begegnungen. Linguistische und literaturwissenschaftliche Zugänge. Themenheft der LiLi – Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik.
Böhm, Alexandra/Steen, Pamela (2023): Editorial. Mehrdeutigkeit und Unsicherheit in Tier-Mensch-Begegnungen: Linguistische und literaturwissenschaftliche Zugänge. In: Böhm, Alexandra/Steen, Pamela (Hrsg.): Mehrdeutigkeit und Unsicherheit in Tier-Mensch-Begegnungen. Linguistische und literaturwissenschaftliche Zugänge. Themenheft LiLi – Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, S. 153–159.
Steen, Pamela (2023): 'Sprechende‘ Tiere im Zoo. Animation, Empathie und Fiktion in Zoo-Doku-Soaps. In: Böhm, Alexandra/Steen, Pamela (Hrsg.): Mehrdeutigkeit und Unsicherheit in Tier-Mensch-Begegnungen. Linguistische und literaturwissenschaftliche Zugänge. Themenheft LiLi – Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, S. 317–349.
Steen, Pamela (2022): Spinnenbrille, Dog-Cam und Gassi mit Ziege – Reflexionen über ein tierlinguistisches Projektseminar. In: Hübner, Andreas/Edlich, Micha/Moss, Maria (Hrsg.): Multispecies Futures. New Approaches to Teaching Human-Animal Studies. Berlin: Neofelis, S. 201–224
Steen, Pamela/Schmid, Ulrike (2021): Diskursive Schemata der Wolfskonstruktion. Auf medialer Spurensuche nach materiell-semiotischen Knoten. In: Mattfeldt, Anna/Schwegler, Carolin/Wanning, Berbeli (Hrsg.): Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit. Perspektiven auf Sprache, Diskurse und Kultur. Berlin, Boston: de Gruyter, S. 123-164.
Steen, Pamela (2020): Selektive Empathie mit Tieren. In: Jacob, Katharina/Konerding, Klaus-Peter/Liebert, Wolf-Andreas (Hrsg.): Sprache und Empathie. Beiträge zur Grundlegung eines linguistischen Forschungsprogramms. Berlin, Boston: de Gruyter, S. 249-284.
Steen, Pamela (2019): Kontaktzone Zoo: Die kommunikative Aneignung von Zootieren. In: Böhm, Alexandra/Ullrich, Jessica (Hrsg.): Animal Encounters. Kontakt, Interaktion und Relationalität. Berlin: J.B. Metzler, S. 257-275.
Steen, Pamela (2018): "Tiere sind die besseren Menschen". Moralisierungen im Web 2.0 aus tierlinguistischer Perspektive. In: Hayer, Björn/Schröder, Klarissa (Hrsg.): Tierethik transdisziplinär. Literatur – Kultur – Didaktik. Bielefeld: transcript, S. 191–210.
In Planung/im Druck befindliche Publikationen
Steen, Pamela/Schwegler, Carolin/Müller, Oliver (Hrsg.) (in Vorb.): Handbuch Sprache und Tier – Mensch – Maschine. Handbücher Sprachwissen (HSW). Herausgegeben von Ekkehard Felder und Andreas Gardt. Berlin, Boston: de Gruyter.
Veranstaltete Tagungen
"Menschen – Tiere – Kultur. Praktiken in der Interspezies-Begegnung" (zusammen mit Heike Rettig)07.-08.10.2021 (online) (gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung und die Universität Koblenz-Landau), https://interspezies.jimdosite.com

Daten und Diskurs
Der Forschungsbereich der Digitalen Daten ist in den qualitativ arbeitenden Geisteswissenschaften bislang kaum erschlossen. Unter dem populären Schlagwort Big Data versammelt sich jedoch eine neue und allumfassende Form der Kommunikation in Gestalt der Nutzung und des Austauschs elektronischer Daten, die räumlich als Erweiterung des eigenen Aktionsradius, zeitlich als Beschleunigung von Such- und Kommunikationsvorgängen erlebt wird. In der einen oder anderen Form verwandeln sich alle Wissenschaften in Digital Humanities. Mit einer von der Fritz Thyssen Stiftung und von der AG Sprache in der Politik e.V. geförderten Tagung an der Universität Leipzig (2016) und einer anschließenden Veröffentlichung (gemeinsam mit Frank Liedtke) wurde dieses Forschungsfeld aus geisteswissenschaftlicher Perspektive bearbeitet.
Die Artikel im Tagungsband verfolgen einerseits das Ziel, dass sie zum Thema Digitale Massendaten auf der sprachlichen Meta-Ebene „semantische Kämpfe“ (Felder 2006) analysieren, indem sie z.B. Ideologien enthüllen, die bei der kommunikativen Aneignung des Digitalen entstehen. In den Dialog treten diese Ansätze andererseits mit solchen, die untersuchen, wie User*innen der digitalen Medien (z.B. Twitter, Kommentarforen) in actu mit dem Digitalen umgehen. Ergänzend dazu werden theoretische Reflexionen angestoßen, die die vielfältigen Zusammenhänge der digitalen Massendaten mit den Begriffen der Macht, des Subjekts und der Programmierung, der Selbstbestimmung und der Algorithmisierung, des Erkenntnispotenzials und des potenziellen Nichtwissens betreffen. Vor allem aufgrund der Methodenvielfalt der Beiträge (Diskurs-, Medien-, Textsortenanalyse) kann dieser Sammelband als qualitativer Brückenschlag der ,traditionellen‘ Geisteswissenschaften zum neuen Forschungsfeld der Digital Humanities verstanden werden, das oftmals vorschnell und einseitig dem spezifischen Themenfeld der Informatik zugeschrieben wird.
Veröffentlichungen
Steen, Pamela/Liedtke, Frank (Hrsg.) (2019): Diskurs der Daten. Qualitative Zugänge zu einem quantitativen Phänomen. (Schriftenreihe "Sprache und Wissen" Bd. 38, herausgegeben von Ekkehard Felder) Berlin, Boston: de Gruyter. (gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung)
Liedtke, Frank/Steen, Pamela (2019): Einführung. In: Steen, Pamela/Liedtke, Frank (Hrsg.): Diskurs der Daten. Qualitative Zugänge zu einem quantitativen Phänomen. Berlin, Boston: de Gruyter, S. 1–13.
Veranstaltete Tagungen
"Diskurs der Daten", Universität Leipzig, 05.-06.02.2016, zusammen mit Frank Liedtke (gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung und die AG Sprache in der Politik e.V.)